Computerspiele: 50 zentrale Titel
Ein neuer Band versammelt Abhandlungen über 50 Computer-, Video- und Mobile-Games, die die Spielwelt seit den 1970er-Jahren geprägt haben. Eine Buchkritik von Rahel Schmitz
Gleich zu Beginn stellt sich eine schwierige Frage, die die beiden Herausgeber in ihrer Einleitung aushandeln: Welche Spiele sind so relevant, dass sie Teil des Buchs sein sollten und welche werden stillschweigend ausgelassen? Die Entscheidung trafen Feige und Inderst anhand einer Reihe von Kriterien, darunter Spiele mit besonderer historischer Bedeutung sowie Spiele, die technologische Durchbrüche markieren oder einzigartige Spielmechaniken präsentieren. Weitere Gesichtspunkte sind die narrative Tiefe und künstlerischen Qualitäten eines Spiels. Hinzu kommt die Rezeption, weswegen auch Titel besprochen werden, die einen besonderen kulturellen und sozialen Einfluss ausüben, zum Beispiel im Rahmen von gesellschaftlichen Debatten, die sie angestoßen haben. Ähnliches gilt für Spiele, die eine starke Präsenz in der Popkultur haben, die einen bemerkenswerten kommerziellen Erfolg vorweisen können und die durch ihre Community hervorstechen. Kurzum: Die Liste an Aspekten, die Feige und Inderst zufolge ein Computerspiel „relevant“ machen, ist ganz schön lang. Hinzu kommt, dass der Sammelband Titel aus verschiedenen Epochen der Digitalspielgeschichte vorstellt und dabei außerdem eine Vielzahl an Genres und Plattformen abdeckt. Entsprechend vielfältig sind sowohl die ausgewählten Spiele als auch die dazugehörigen Beiträge. Wichtig ist dabei, dass es nicht das Ziel des Buchs ist, die „wichtigsten Spiele aller Zeiten“ vorzustellen – sondern lediglich, 50 relevante Titel zu beleuchten.
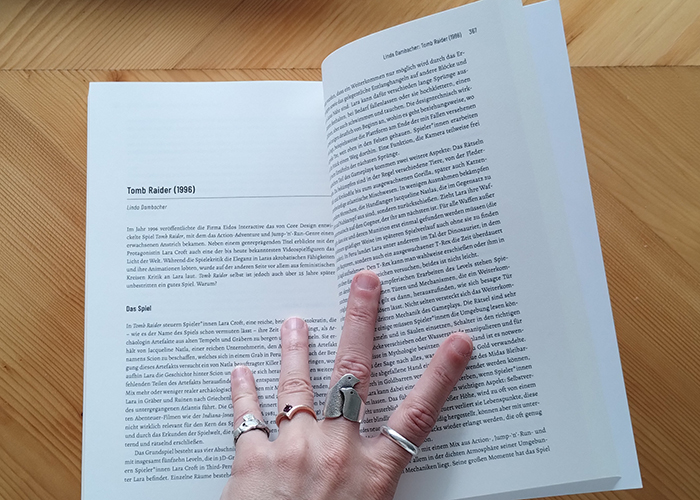
Genau hier liegt eine besondere Stärke des Buchs: Jeder Aufsatz hat seinen eigenen Stil und seinen eigenen Blick auf das jeweilige Spiel. Während Felix Zimmermann und Tobias Winnerling ergründen, inwiefern Anno 1602 in seiner historischen Inszenierung eine kolonialismusfreie Fantasiewelt erfindet, konzentriert sich Britta Neitzel in ihrem Beitrag zu Ingress darauf, wie das Mobile Game den Weg bereitete für Nachfolger wie Pokémon Go und dabei die Community aktiv in die Spielentwicklung einbezog. Stay-Forever-Hörerin Linda Dambacher wiederum befasst sich mit der Relevanz von Tomb Raider in Hinblick auf die Darstellung und insbesondere die Rezeption von weiblichen Videospielheldinnen. Dagegen nimmt Robert Bannert in seinem Aufsatz zu Sonic eher die technischen Besonderheiten des Spiels in Augenschein. Bei all diesen Beiträgen gilt stets: In der Kürze liegt die Würze, nur ein Text ist länger als zehn Seiten (Literaturverzeichnis inklusive).
Dadurch erhält man selbst bei Spielen, die man gut kennt, zwar nicht unbedingt neues Wissen, aber doch frische Denkanstöße. Bei Titeln, die man selbst gar nicht oder nur wenig gespielt hat, bietet der Sammelband einen guten und kurzweiligen Einstieg, um deren Bedeutung nachvollziehen zu können. Besonders positiv: Für jedes besprochene Spiel folgt nach dem Aufsatz auch eine Liste an Empfehlungen für die weitere Lektüre.
Dass die Perspektiven, die die Beitragenden einnehmen, so heterogen sind, liegt unter anderem daran, dass Computerspiele: 50 zentrale Titel kein rein wissenschaftliches Buch ist. Zu den Autorinnen und Autoren zählen nicht nur Digitalspielforschende, sondern auch Fachjournalistinnen und -journalisten sowie Beitragende aus der Games-Publizistik.
Allerdings gibt es auch kleinere Kritikpunkte, die das Lesevergnügen schmälern. Da wäre einmal das Ästhetische: Neben dem eher lieblos gestalteten Cover – ausgerechnet bei einem Buch, das in so viele spannende, ästhetische Computerspielwelten einlädt! – fällt natürlich auf, dass keinerlei Bilder abgedruckt sind. Dabei hätten nahezu alle Beiträge von ein, zwei visuellen Eindrücken profitiert, die das Beschriebene illustrieren. Ein zweiter Punkt betrifft die Lesbarkeit: Schon der in Großbuchstaben gedruckte Klappentext ist nahezu unleserlich; die eigentlichen Beiträge wurden darüber hinaus in einer winzigen Schriftgröße gedruckt. Doch der wohl größte und wichtigste Kritikpunkt betrifft das katastrophale Lektorat. Es gibt kaum einen Beitrag, in dem nicht mehrere Tipp- oder Grammatikfehler sowie uneinheitliche Schreibweisen derselben Begriffe ins Auge springen.
All diese Kritikpunkte betreffen ausschließlich die Präsentation des Sammelbands, nicht jedoch dessen Inhalt. Denn der kann sich von der ersten bis zur letzten Seite sehen lassen.
An dieser Stelle sei noch ein kleines Trivia erwähnt: An einer Stelle wird im Buch sogar auf Stay Forever verwiesen. Ihr wollt wissen, wo und in welcher Weise? Dann lest das Buch!

